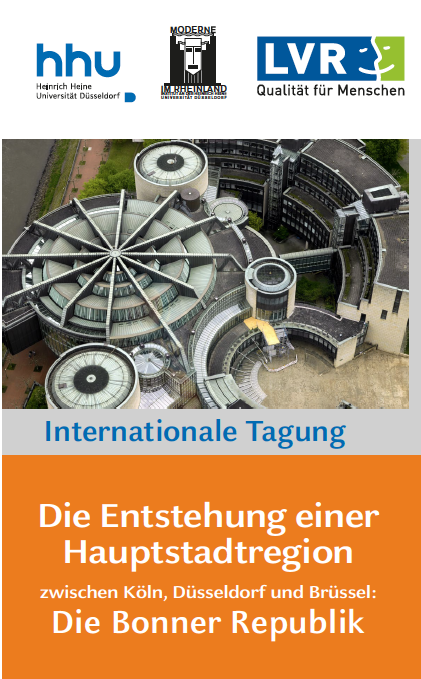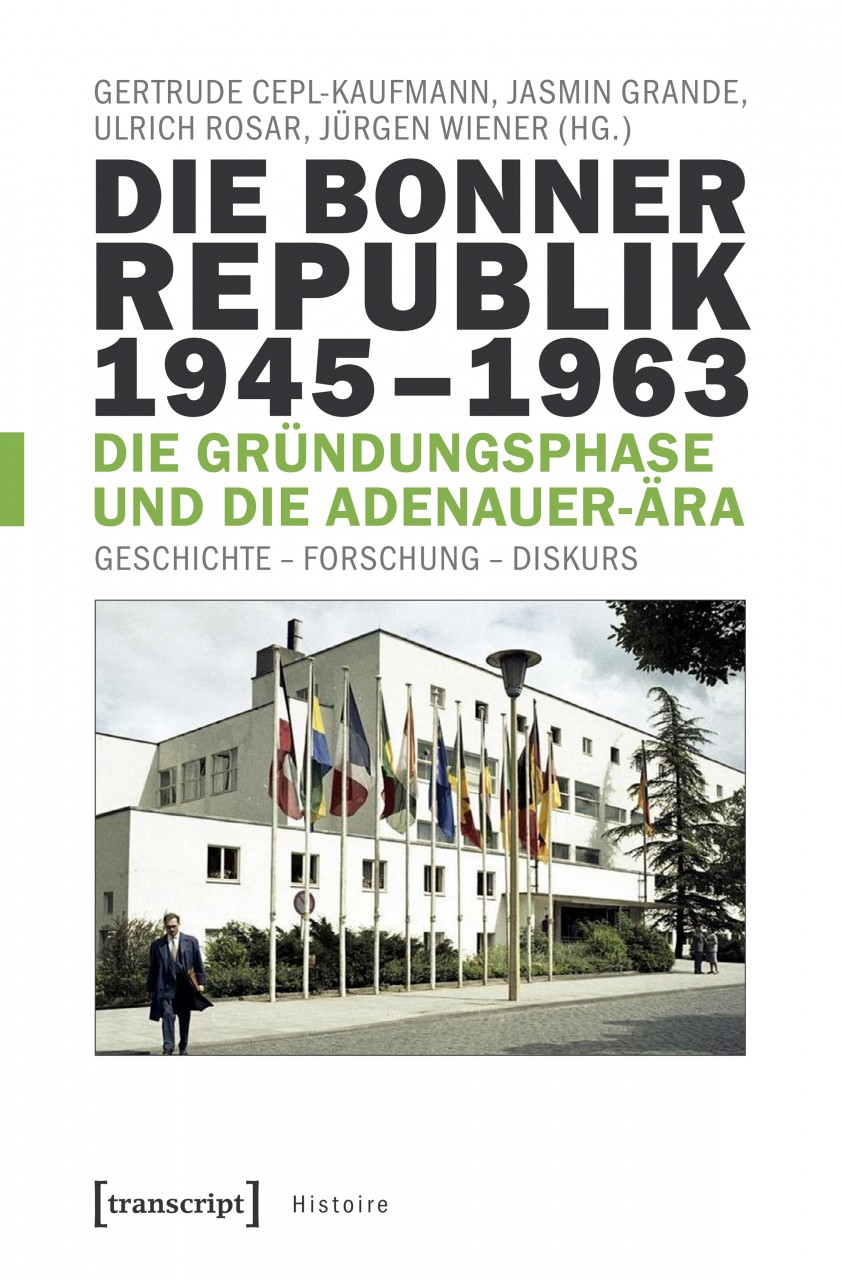Im Wintersemester 2017/18 stehen die 1960er und 1970er Jahre im Fokus der Ringvorlesung "Die Bonner Republik. Forschung - Diskurs - Öffentlichkeit". Im Programm tragen Professorinnen und Professoren und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Heinrich-Heine-Universität aus ihren aktuellen Forschungen vor.
Die Bonner Republik ist, daran erinnern uns aktuell die Nachrufe auf Helmut Kohl und Heiner Geißler, als eine Zeit des Wiederaufbaus und beginnender Prosperität in das regionale und das politisch-nationale Gedächtnis eingegangen. Doch hält diese Gesamtperspektive auf den abgeschlossenen Zeitraum einer kritischen Betrachtung stand? Welche Erkenntnisse lassen sich für die Zukunft aus den Positionen gewinnen, die in der Bonner Republik für Furore gesorgt haben und heute Teil unserer Gegenwart sind?
Die Kooperationspartner sind neben der Stadt Düsseldorf die Veranstaltungsorte: Forum Freies Theater, Goethe Museum Düsseldorf/Anton-und-Katharina-Kippenberg-Stiftung, Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus, das Stadtarchiv und die Stadtbüchereien Düsseldorf.
Programm (so nicht anders angezeigt, finden die Vorträge von 17.-19.00 Uhr statt):
26.10.2017 Haus der Universität, Prof. Dr. Michael C. Schneider: Zur Wirtschaftsgeschichte der Bonner Republik
Mit der Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland verbinden sich Schlagworte wie „Währungsreform“, „Wirtschaftswunder“, „Strukturwandel“, „Deutschland AG“ oder auch „Rheinischer Kapitalismus“. Der Vortrag beleuchtet zum einen Grundzüge der bundesrepublikanischen Wirtschaftsentwicklung seit den späten 1940er Jahren bis in die 1980er Jahre. Zum anderen diskutiert er aus einer eher unternehmenshistorischen Perspektive, inwiefern Konzepte wie jenes der „Deutschland AG“ oder des „Rheinischen Kapitalismus“ angemessen sind, sei es, um die Spezifik der Verflechtung von Banken und Industrieunternehmen zu erfassen, sei es, um die bundesrepublikanische Wirtschaftsordnung als Ganze zu beschreiben.
02.11.2017 Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus, Raum 412, Prof. Dr. Gertrude Cepl-Kaufmann: Gruppenspiele. Zur Kultur- und Literatursoziologie in der Bundesrepublik
Auf dem kulturellen Feld der Bonner Republik sind viele Akteure unterwegs, sie potenzieren ihre Kräfte und finden gemeinsame Ziele, treffen aber oft auf konkurrierende Interessen Anderer. In besonderer Weise sind die Gruppe 47 und die Dortmunder Gruppe 61 normgebend auf dem literarischen Feld. Interessant sind in diesem Zusammenhang die Verlagslandschaft, Gattungen (mit einem Blick aufs Theater), Formen der Öffentlichkeit, auch die Wahrnehmung der kultursoziologischen Unterschiede, nicht zuletzt die Bedeutung für das kulturelle Profil der Bonner Republik.
09.11.2017 Forum Freies Theater, Juta, Dr. Jasmin Grande: „Fuck-You (!)“. Zur „Super-Garde“ der „Postmoderne“ an Rhein und Ruhr. Verhandlungen des Literaturbegriffs in den 1960er Jahren
„Fuck-You (!)“, die „Super-Garde. Prosa der Beat- und Pop-Generation“ betitelten die Akteure der Kölner Szene von Ralf-Rainer Rygalla bis Vagedis Tsakiridis ihre Anthologien, in denen sie die Kölner Szene mit der amerikanischen Gegenwartsliteratur bekannt machten. Die Titel provozieren und stehen für den Perspektivwechsel in der Literatur der späten 1960er Jahre. Doch tritt man einen Schritt zurück, so stellt sich das Ganze zunächst ganz moderat dar: Anfang der 1960er Jahre brach in Dortmund eine Schriftstellergruppe zur Revolution der Literatur auf. Die Dortmunder Gruppe 61 wollte der Arbeitswelt literarischen Ausdruck verleihen. Die frühen Fotografien zeigen eine bürgerliche Kaffeerunde, Männer in Anzügen, Frauen mit Hochsteckfrisuren. Beschaulich!
Ende der 1960er Jahre erfolgte der Riss, er machte sich auch in der Dortmunder Gruppe 61 bemerkbar, wurde als „Tod der Literatur“ (Kursbuch 15) debattiert, von Hans Magnus Enzensberger in „Gemeinplätzen, die neueste Literatur betreffend“ umrundet und mit der Einführung der Vokabel „Postmoderne“ auf eine epochale Herausforderung gebracht.
Der Vortrag stellt exemplarische Positionen zur Frage nach dem Potential der Literatur Ende der 1960er Jahre vor und fokussiert dabei insbesondere auf Aktivitäten an Rhein und Ruhr. Am Beispiel von Rolf Dieter Brinkmann, Wolfgang Körner und Günter Wallraff wird nach der Postmoderne in Köln und Dortmund gefragt, nach poetologischen Strategien, Netzwerken und internationalen Austauschprozessen.
23.11.2017 Goethe Museum Düsseldorf/Anton-und-Katharina-Kippenberg-Stiftung, Prof. Dr. Volker C. Dörr: „Widerstand der Realität gegen das vorschnelle Sinnbedürfnis“. Dieter Wellershoff und sein Programm eines Neuen Realismus
Mitte der 1960er Jahre entwirft Dieter Wellershoff, seinerzeit Lektor beim Kölner Verlag Kiepenheuer & Witsch, das Programm eines ‚Neuen Realismus‘, von dem bald und bis heute (aber womöglich zu Unrecht) behauptet wird, es habe zur Bildung einer sog. ‚Kölner Schule‘ geführt. Der Vortrag will das Programm in seinem sozial- und literarhistorischen Kontext darstellen und nach seinen Voraussetzungen und Konsequenzen, sowie auch seinen Grenzen, fragen. Zudem sollen die ästhetischen Merkmale seiner Umsetzung – vor allem in Wellershoffs eigenem Romanschaffen dieser Zeit – in den Blick genommen werden.
30.11.2017 Haus der Universität, Prof. Dr. Hans Körner: „Jeder Mensch ein Künstler“. „Naive Malerei“ in der Bonner Republik (1960er und 1970er Jahre)
11 130 Bilder, gemalt von Menschen der Bundesrepublik Deutschland, wurden 1972 für einen Wettbewerb eingereicht, den Ende 1971 das Museum in Hamburg-Altona zusammen mit der Zeitschrift „Stern“ und der Hamburger Westbank AG ausgeschrieben hatte. Der Wettbewerb markiert einen Höhepunkt in der Popularisierung der Laienmalerei bzw. der sogenannten „naiven“ Malerei. Galt der Zöllner Henri Rousseau noch als Außenseiter der Kunst, so war „naive“ Malerei jetzt in die gesellschaftliche Mitte gerückt. Hausmänner und Hausfrauen, Stars und Politiker malten in den 1960er und 1970er Jahren „naiv“. In den 1970er Jahren verkündete Joseph Beuys: „Jeder Mensch ist ein Künstler“. Gibt es einen Zusammenhang?
07.12.2017 Stadtarchiv Düsseldorf, Prof. Dr. Guido Thiemeyer: Die „Bonner Republik“ in der Europäischen Integration. Die „Europäisierung“ von Verfassung und Gesellschaft
Die Bundesregierung war zwischen 1949 und 1990 ein wesentlicher Akteur in der Europäischen Integration. Allerdings wirkte die Integration auch auf die Bundesrepublik zurück. Der Vortrag untersucht, wie das politische System der „Bonner Republik“ und die westdeutsche Gesellschaft durch die europäische Integration verändert wurden.
14.12.2017 Beginn: 12.00 Uhr Hörsaal 5A, 25.11, JuniorProf. Dr. Christof Baier „Reformgrün“. Freiraumplanung im Universitätsbau der 1960er und 1970er Jahre
Der rasanten Ausbau der Hochschullandschaft in der Bundesrepublik Deutschland in den 1960er und 1970er Jahren führte zu einem beispiellosen Bauboom. Neben Universitätsneugründungen wie in Bochum (1962) oder dem Ausbau bestehender Einrichtungen in Volluniversitäten (Düsseldorf 1965) wurden auch an bestehenden Universitätsstandorten wie etwa in Köln umfangreiche Neubauprojekte realisiert. Die zumeist mit hohem Anspruch geplante und realisierte, oft recht spröde - mit dem Begriff 'Brutalismus' fälschlich negativ bewertete - Architektur ist in den letzten Jahren stärker in den Fokus auch einer breiteren Öffentlichkeit getreten. Die Freiraumplanung jedoch, welche unabdingbar zu diesen massiven Architekturen gehört, wurde bis heute fast nicht wahrgenommen. Ein Ziel des Vortrags ist es daher, die besonderen Qualitäten der in diesen Aufbaujahren der Universitätslandschaft der Bonner Republik realisierten Freiräume aus den zeitgenössischen Diskussionen um Form und Funktion des öffentlichen Raums 'Unigrün' heraus klar zu benennen. Schließlich soll vor diesem Hintergrund der heutige, oft unbefriedigende Zustand der universitären Freiräumen thematisiert werden.
Achtung: Der Vortrag beginnt bereits um 12.00 Uhr, um 13.00 Uhr findet ein gemeinsamer Spaziergang über die Freiflächen des Campus’ mit JuniorProf. Dr. Christof Baier statt.
11.01.2018 Zentralbibliothek, Lernstudio 1, JuniorProf. Dr. Ulli Seegers: Kunstmarkt in der Bonner Republik (1960-1975)
Während die Kasseler Documenta in den 1950er Jahren den Anschluss an die während der NS-Zeit verfemte moderne Kunst suchte, bildete sich im Rheinland rund um die Düsseldorfer Kunstakademie und den ersten Kölner Kunstmarkt (1967) eine lebendige Kunstszene mit großer internationaler Strahlkraft. Ein Netzwerk von Künstlern, Galeristen und Sammlern legte im Westen der jungen Republik das Fundament für einen florierenden Kunstmarkt, der nicht nur längst Kunstgeschichte geschrieben, sondern auch die Strukturen für einen global umspannenden Handel mit Kunst vorgeprägt hat. Der Vortrag stellt zentrale Akteure und Entwicklungslinien des rheinischen Kunstmarktes in den 1960er und 1970er Jahren vor.
18.01.2018 Haus der Universität, Prof. Dr. Winfrid Halder: In Deutschland überflüssig? Alfred Döblin und die Bonner Republik
Alfred Döblin (1878-1957) war bereits im November 1945 wieder in Deutschland. Damit war er der erste deutsche Schriftsteller von Weltrang, der aus dem Exil zurückkehrte, um beim kulturellen Wiederaufbau des nach 12 Jahren NS-Diktatur in jeder Beziehung verheerten Landes mitzuhelfen. Döblin, der insbesondere nach dem Erscheinen seines erfolgreichsten Romans „Berlin Alexanderplatz“ (1929) als aussichtsreicher Kandidat für den Literaturnobelpreis galt, war im Februar 1933 zunächst in die Schweiz, später weiter nach Frankreich und in die USA emigriert.
Eigentlich hätte man sich in Westdeutschland glücklich preisen müssen, dass ein so prominenter Autor wie Döblin nicht nur wieder da, sondern auch nach Kräften bemüht war, sich in den Dienst eines Neubeginns zu stellen. Gleichwohl wurden die folgenden Jahre für Döblin zu einer bitteren Enttäuschung, und zwar sowohl was seine politischen Hoffnungen wie auch was seine Wahrnehmung als immer noch höchst produktiver Autor anging. Vollständig desillusioniert verließ er die junge Bundesrepublik 1953 und ging wieder nach Paris. An den mit ihm persönlich gut bekannten ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss schrieb er zum Abschied, er sei „in Deutschland überflüssig“.
Warum stieß Döblin auf so viel Unverständnis und Ablehnung? Weil er jüdischer Herkunft und der Antisemitismus untergründig noch immer virulent war? Weil man dem in der Weimarer Republik als bekennender „Linker“ bekannten Autor mißtraute, wenngleich sich Döblin von früheren politischen Positionen distanzierte und inzwischen bekennender Katholik war? Weil man ihn als „Besatzer“ wahrnahm, da Döblin seit 1936 französischer Staatsbürger und seit 1945 zunächst Mitarbeiter der Militärregierung in der französischen Besatzungszone war? Weil er, politischen Differenzen zum Trotz, Kontakt hielt zu alten Freunden, die jetzt in der DDR prominente Rollen spielten, nämlich zu Bert Brecht und Johannes R. Becher?
Der Vortrag geht folglich der Grundfrage nach, warum sich Alfred Döblin in der jungen „Bonner Republik“ fehl am Platze fühlen mußte.
25.01.2018 Roy-Lichtenstein-Saal, 22.01 Hörsaal 2A, Prof. Dr. Ulrich Rosar: Politisch-kultureller Wandel 1965 bis 1984: Eine stille Revolution?
Als Bundeskanzler Brandt in seiner Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 den legendären Satz sagte „Wir wollen mehr Demokratie wagen.“ traf er einen gesellschaftlichen Nerv. Ausgehend vom gewachsenen Wohlstand der Adenauer- und Erhard-Ära sowie der zunehmenden, insbesondere durch Studierende formulierten Kritik an den bestehenden politischen Verhältnissen, griff er damit einen tiefgreifenden Wunsch nach politisch-kultureller Veränderung in der arrivierten Bonner Republik auf.
Aber war dieses Streben nach einer partizipatorischen Politikkultur das Projekt einer kleinen, intellektuell geprägten Avantgarde? Oder trug Brandt hier einem stillen, aber tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel Rechnung, den er als einer der ersten erkannte und verstand? Ausgehend von sozialwissenschaftlichen Erklärungsmodellen des politisch-kulturellen Wandels und basierend auf Umfragedaten der 1960er bis 1980er Jahre möchte der Vortrag hierauf eine Antwort geben.
01.02.2018 Roy-Lichtenstein-Saal, 22.01 Hörsaal 2B, Prof. Dr. Jürgen Wiener: Campus-Universitäten zwischen 1960 und 1975
08.02.2018 n.n., Dr. Thomas Gerhards, Dr. Uta Hinz:„Aufruhr am Rhein? - ,1968‘ in nationaler und regionaler Perspektive“
Die 1960er Jahre waren eine Zeit dynamischen gesellschaftlichen Wandels, die vielfach als Zäsur in der Geschichte der „Bonner Republik“ bezeichnet wurde. Zahlreiche Wandlungsprozesse nahmen bereits in den 1950er Jahren ihren Ausgang und kulminierten 1968 in den Studierendenprotesten. Diese soziale Bewegung war ohne Zweifel ein globales Phänomen mit nationalen Besonderheiten, aber auch mit regionalen Unterschieden. Berlin und Frankfurt waren die bundesrepublikanischen Zentren der Revolte, allerdings organisierten sich um die Universitäten in Köln, Bonn oder Münster ebenfalls lokale Protestbewegungen. Ruhig blieb es – noch – an der neuen Universität Düsseldorf. Zu fragen ist, ob die moderne transnationale Betrachtungsweise der „68er Bewegung“ nicht auch um eine transregionale zu erweitern ist.
Zur Ringvorlesung im Wintersemester 2016/17
Mit der Diskussion um die Tragfähigkeit des Bildes einer „Stunde Null“ beginnt die Bonner Republik. Die Ringvorlesung nimmt diese Frühphase aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven in den Blick und steckt so erste Aspekte zum Gesamtbild ab. Von den Vergleichsebenen zwischen früheren Demokratiebewegungen, über die literarischen Anknüpfungspunkte, künstlerische Aufbrüche, Gartenkonzepte in den Bombenlandschaften, Umgang mit einer Trauerkultur bis hin zum Umgang mit dem kolonialen Erbe stellen Professor/Innen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Aspekte der frühen Bonner Republik vor.